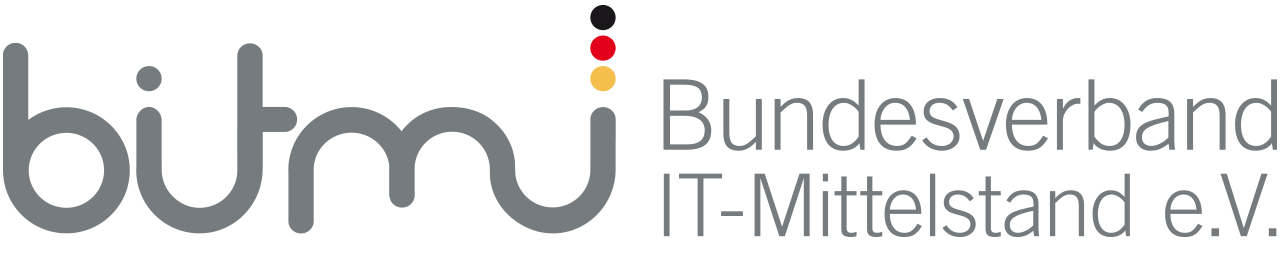Geeonx ist eine schlanke, plattformunabhängige grafische Oberfläche für Windows, Linux und macOS in Form einer shared Library. Die Bibliothek bietet ein eigenes Fenstersystem und übernimmt die Darstellung und Verwaltung von Fensterinhalten, Dialogboxen, Grafiken, Text, Pull-down- und Pop-up-Menus. Die Oberflächen werden mit dem Tool GeeonxCreator gestaltet.
Ein C-Sourcecode für alle Systeme
Das Ziel von Geeonx ist, die schnelle und einfache Entwicklung von Anwendungen mit grafischen Oberflächen zu ermöglichen. Geeonx ist eine C-Library und verfolgt den Ansatz: ein C-Sourcecode für alle Systeme. Dies hat den Vorteil, dass der Aufwand für eine plattformübergreifende Entwicklung massiv reduziert wird. Durch die Verwendung von C erhält man – im Gegensatz zu Java – jeweils native auf der jeweiligen Zielplattform ausführbare Anwendungen.
Entlastung des Entwicklers
Geeonx entlastet den Entwickler. Mit der Funktion gee_draw_all_objects() werden beispielsweise sämtliche GUI-Elemente inklusive der Fenster und Fensterinhalte neu gezeichnet. Als Fensterinhalte werden sämtliche Grafiken, Texte und GUI-Elemente erfasst. Auf den Zielplattformen laufen Geeonx-Anwendungen zusammen mit anderen Anwendungen integriert in der Zieloberfläche. Geeonx eignet sich für Desktop-, Embedded- und Gaming-Anwendungen.